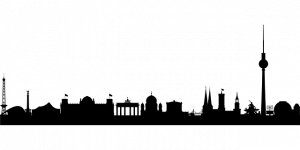Begriffe wie Ghosting, Breadcrumbing oder Gaslighting sind längst fester Bestandteil des digitalen Alltags.
Wer heute von einem Date nicht mehr hört, spricht von Ghosting. Wenn jemand gezielt Hoffnungen schürt, ohne eine echte Bindungsabsicht verfolgt, ist von Breadcrumbing die Rede. Wird die eigene Wahrnehmung systematisch infrage gestellt, lautet der Vorwurf Gaslighting.
Doch obwohl diese Begriffe erst einmal neu wirken, beschreiben sie in Wahrheit Verhaltensweisen, die es schon lange gibt. Neu ist also nur, wie wir sie benennen – und dass sie so offen diskutiert werden.
Neue Begriffe für alte Dynamiken
Ghosting etwa meint das plötzliche, kommentarlos bleibende Verschwinden aus einer Verbindung – meist nach einem Date, einem Flirt oder sogar einer längeren Beziehung. Die Psychologie beschreibt dies als „kontaktabbrechendes Vermeidungsverhalten“.
Gaslighting hingegen stammt ursprünglich aus dem gleichnamigen Theaterstück von 1938. Es bezeichnet eine Form psychologischer Manipulation, bei der Menschen systematisch an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln sollen, meist vor dem Hintergrund emotionaler Abhängigkeiten.
Dass solche Begriffe heute zum Allgemeinvokabular gehören, hängt auch mit den modernen Kommunikationsformen zusammen: Schnelligkeit, ständige Erreichbarkeit und Oberflächlichkeiten prägen die digitalen Begegnungen. Besonders sichtbar werden diese Phänomene in sozialen Netzwerken und auf Plattformen zur Beziehungssuche. Auch auf Dating Apps zeigen sich diese Verhaltensweisen häufig – nicht zwingend, weil die Plattformen an sich toxisch sind, sondern weil sie ein Umfeld schaffen, in dem Verbindlichkeit optional erscheint.
Was Studien über digitale Beziehungskultur zeigen
Die Sozialpsychologie spricht von einem deutlichen Wandel in der Beziehungskommunikation.
Eine Studie der University of Kansas zeigt, dass Menschen, die in digitalen Kontexten Kontakt aufnehmen, Bindung häufig anders definieren als in klassischen Beziehungsmodellen. Ghosting wird von vielen Befragten so beispielsweise nicht als Unhöflichkeit, sondern als legitime Form des Rückzugs betrachtet – besonders, wenn die Kommunikation auch unverbindlich begann.
Weitere Untersuchungen, etwa von der Stanford University, weisen darauf hin, dass die digitale Kommunikation deutlich mehr Raum für Missverständnisse lässt. Ohne Mimik, Tonfall oder Körpersprache fehlt ein großer Teil der sozialen Information. Dies begünstigt wiederum Unsicherheiten, aber auch manipulative Strategien.
Zwischen Empowerment und Etikettierung
Dass sich unsere Sprache entwickelt, ist grundsätzlich positiv. Die Begriffe ermöglichen es Betroffenen, die problematischen Dynamiken besser zu erkennen und zu benennen. Gerade die Bezeichnung Gaslighting hat vielen geholfen, eine bestimmte Form psychischer Gewalt sichtbar zu machen, die früher kaum greifbar war.
Doch der inflationäre Gebrauch dieser Begriffe birgt auch Risiken. Nicht bei jeder Meinungsverschiedenheit handelt es sich um Gaslighting, nicht bei jeder Funkstille um Ghosting. Wenn komplexe Situationen auf ein Wort reduziert werden, entsteht schnell eine Vereinfachung, die der Wirklichkeit nicht gerecht wird. Dadurch können potentiell echte Probleme schnell bagatellisiert oder falsch etikettiert werden.
Digitale Nähe braucht neue Verantwortung
Was bleibt, ist eine neue gesellschaftliche Herausforderung. Die Kommunikation in digitalen Räumen verlangt neue Formen der Verantwortung. Nähe, Aufmerksamkeit und Respekt funktionieren auch dort, wo sich Menschen nie persönlich begegnen.
Sprachlich bewegen wir uns inzwischen sicherer durch diese Themen. Was fehlt, ist allerdings die Fähigkeit, mit der neuen Unverbindlichkeit umzugehen – oder sie bewusst zu vermeiden. Die Begriffe helfen beim Verstehen. Sie ersetzen aber nicht die eigene Reflexion. Ghosting, Gaslighting und Co. sind ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Umbruchs in Sachen Beziehungskultur. Sie machen psychologische Muster greifbar – und gleichzeitig deutlich, wie sehr sich Nähe und Distanz im digitalen Raum verschoben haben.
(Bildquelle: Pixabay.com – CC0 Public Domain)