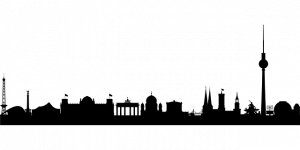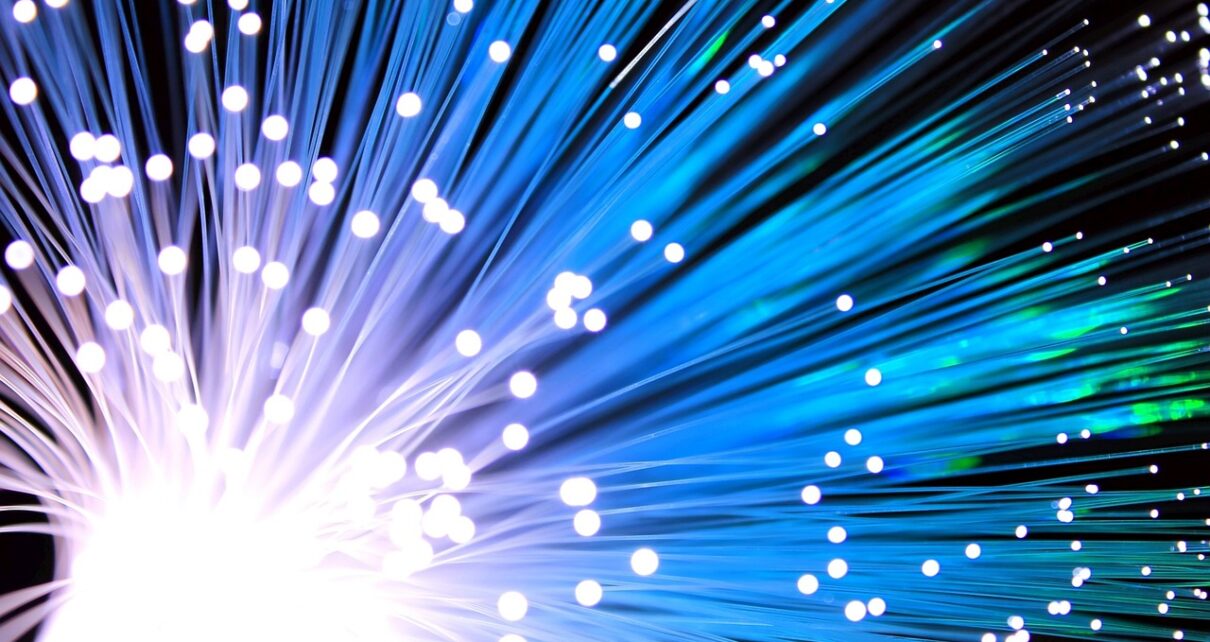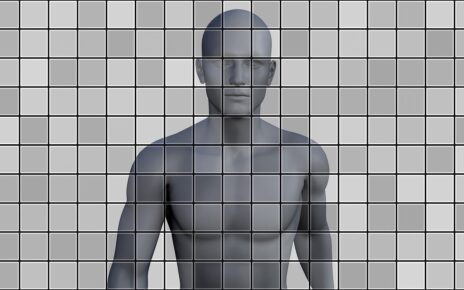Die Datenmenge, die täglich durch Haushalte und Firmen rauscht, wächst rasant. Videokonferenzen, 4K-Streaming, Cloud-Backups und vernetzte Maschinen senden unablässig Bits und Bytes. Kupferleitungen können diese Ströme nur mit aufwendigen Tricks bändigen. Glasfasern lösen das Problem eleganter: Ein Lichtimpuls saust nahezu verlustfrei durch einen dünnen Glaskern, weitgehend immun gegen Störfelder. Wer verstehen möchte, weshalb Lichtleiter als Rückgrat der digitalen Zukunft gelten, findet hier die wichtigsten Hintergründe, klar geordnet und ohne Technikjargon.
Warum Glasfaser Kupfer überholt
Kupfer nutzt elektrische Signale. Diese leiden unter Dämpfung und Übersprechen, was mit wachsender Frequenz zu Problemen führt. Streaming in hoher Auflösung und Echtzeit-Gaming treiben die Frequenzanforderungen parallel nach oben. Glasfaser arbeitet anders. Photonen tragen die Information, gleiten im Kern entlang und verlieren kaum Energie. Dadurch bleiben Bandbreiten selbst über viele Kilometer stabil. Das senkt Fehlerraten und erspart komplizierte Vectoring-Algorithmen, die Kupferleitungen erst mühsam optimieren. Steigende Nachfrage nach Gigabit-Internet verschiebt das Kostengefüge. Wo Tiefbaufirmen Straßenzüge in Serie erschließen, sinken die Baukosten pro Meter. Zeitgleich wächst der Wettbewerb unter Providern. Mitunter die Glasfaser Tarife von o2 haben ein niedriges Preisniveau, das vor wenigen Jahren VDSL vorbehalten war.
Kommunen nutzen Fördertöpfe, um weiße Flecken zu schließen. Sobald ein Knotenpunkt ans Glasfasernetz angeschlossen ist, entstehen Skaleneffekte: Weitere Straßenzüge lassen sich ohne neue Genehmigungsverfahren anbinden, regionale Datacenter siedeln sich an, und öffentliche WLAN-Hotspots profitieren von hoher Geschwindigkeit. Das Ökosystem stimuliert sich selbst. Investoren erkennen stabile Einnahmequellen, während Bewohner von kürzeren Laufzeiten, wechselfreundlichen Verträgen und klareren Leistungsangaben profitieren. Kupfer verliert damit schrittweise seine Rolle als Standard, weil Nutzer praktische Vorteile wie geringere Latenz und symmetrische Bandbreiten unmittelbar spüren.
So funktioniert die Datenübertragung mit Licht
Eine einzelne Faser scheint unscheinbar, doch ihre innere Struktur ist hochpräzise. Der Kern besteht aus extrem reinem Quarzglas. Ein Mantel mit etwas niedrigerem Brechungsindex umgibt ihn. Diese Konstellation zwingt Licht, im Kern zu bleiben – Totalreflexion heißt der Effekt. Ein Laser wandelt digitale Bits in rasche Lichtpulse. Jede Pulsfolge entspricht einem Datenpaket. Obwohl Licht sich im Vakuum schneller bewegt, als es das Glas zulässt, erreicht es immer noch rund zwei Drittel dieser Maximalgeschwindigkeit. Die Verzögerung bleibt im Alltag vernachlässigbar.
Auf Langstrecken summieren sich jedoch Dämpfung und Streuung. Optische Verstärker (EDFA) werten deshalb das Signal auf. Sie stehen seltener als Kupfer-Verstärker, denn Photonen verlieren deutlich weniger Energie. Gleichzeitig steigt die Kapazität, weil Betreiber mehrere Wellenlängen über ein Faserpaar schicken können. Wellenlängenmultiplexing macht aus einer Leitung ein Datenbündel, ohne erneut den Bürgersteig aufzureißen.
Feldtests haben gezeigt, dass Kapazitätsreserven von heute oft erst zu einem Bruchteil genutzt werden. Das verschafft Netzbetreibern Planungssicherheit, wenn künftige Anwendungen wie immersives Virtual Reality oder Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation flächendeckend Einzug halten. Eine solche Reserve wäre in Kupfernetzen nur mit massivem Neubau erreichbar und würde hohe Betriebskosten verursachen.
Ausbauvarianten von FTTC bis FTTH
Nicht jede Glasfaser endet in der Wohnungsdose. Bei FTTC, „Fiber to the Curb“, reicht sie nur bis zum Straßenverteiler. Das letzte Stück bleibt Kupfer, meist ein altes Telefonkabel. Diese Variante benötigt kaum Eingriffe auf Privatgrundstücken und kommt deshalb schnell voran. Die Reststrecke limitiert jedoch die Bandbreite, weil elektromagnetische Störungen in Mehrfachadern steigen, sobald mehrere Anschlüsse parallel arbeiten.
FTTB, „Fiber to the Building“, verlegt die Faser bis in den Hauskeller. Ein Medienkonverter speist Koax- oder Ethernet-Leitungen, die im Gebäude bereits existieren. Die Kupferstrecke schrumpft dadurch auf wenige Meter. Netzanbieter werben hier oft mit Gigabit-Downstreams, doch der Upstream bleibt etwas darunter, weil die Hausverkabelung noch elektrische Signale nutzt.
FTTH, „Fiber to the Home“, führt die Leitung komplett bis zur Glasfaser-Teilnehmerdose in der Wohnung. Licht bleibt ungestört bis zum Router. Up- und Downstream erreichen identische Raten, die Latenz sinkt merklich, und elektromagnetische Störeinflüsse entfallen vollständig. Der Tiefbauaufwand steigt, weil jede Hauswand und jede Wohnung durchbohrt werden muss. In dicht besiedelten Quartieren lohnt sich dieser Aufwand, da viele Verträge pro Meter Trasse realisiert werden.
Auf dem Land startet der Ausbau oft mit FTTC, um eine Grundversorgung sicherzustellen. Sobald genügend Haushalte wechseln, rentiert sich die schrittweise Umstellung auf FTTH. Die technische Infrastruktur ist modular ausgelegt: Neue Glasfaserstränge lassen sich in vorhandene Leerrohre einziehen, und aktive Netztechnik wird im laufenden Betrieb ausgetauscht.
(Bildquelle: Pixabay.com – CC0 Public Domain)